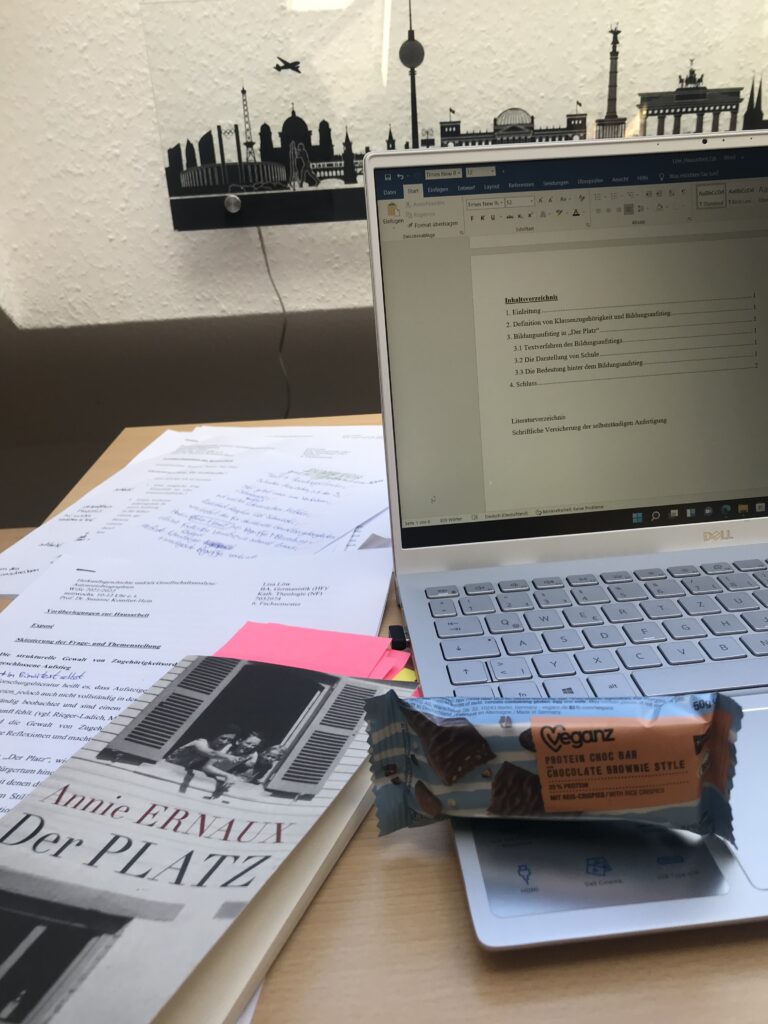Wie ich meine Herkunft, meine Sprache und meine Kultur verleugnete, um meinen Bachelor-Abschluss zu bekommen.
„Um diesen Kurs zu bestehen, müssen Sie sich wirklich voll reinhängen. Ich erwarte 100 Prozent von Ihnen.“ Ich sitze vor meinem Laptop und höre mir an, was meine Uni-Professorin von mir fordert. Es ist mein letztes Seminar vor meiner Bachelorarbeit, doch statt stundenlang in der Bib zu pauken, würde ich das Semester coronabedingt in meinem Dachzimmer ausharren. „Wir werden jede Woche ein anderes Buch besprechen. Glauben Sie mir, ich merke, wenn Sie nur die Wikipedia-Zusammenfassung lesen.“ Mein Stresspegel ist schon jetzt so hoch, dass ich kaum noch richtig zuhören kann. Wenige Minuten vorher hat mich die Professorin vor dem gesamten Kurs als einziges Arbeiterkind vorgestellt und gesagt, dass ich es besonders schwer haben werde. Mir würden die
Eltern fehlen, die mich schon im Kindergartenalter mit in die Oper und ins Theater schleppten und meinen jungen Geist mit klassischer Kultur nährten. Wer hätte gedacht, dass die Teletubbies einmal
daran schuld sein sollten, dass mein Bachelor-Abschluss auf der Kippe steht.
Für mich steht fest: Ich muss mehr leisten als alle anderen Elitestudenten hier. 110 Prozent geben. Mindestens. Mein Blick fällt auf die Literaturliste: Ingeborg Bachmann, Didier Eribon, Anni Ernaux. Es geht um die Politisierung der Scham, um Verleiblichung von Erinnerungen und um autobiografische
Exposition. Für mich geht es darum, auf Teufel komm raus zu bestehen. Koste es, was es wolle. Spoiler: Es kostete meine Selbstachtung, meinen Schlaf und meine eigene Meinung.
Ich bekam „Der Platz“ von Anni Ernaux zugeteilt. Obwohl ich die 94 Seiten solange las, bis ich sie beim Hochfahren meines Laptops (was im Onlinestudium wohl der Vorbereitungszeit in der S-Bahn gleichkam) auswendig herunterbetete, verstand ich kein einziges Wort darin. Meine Professorin ließ
mich das keine Sekunde vergessen: „Bisher sind Sie vielleicht mit stumpfen Rezitieren
durchgekommen, aber bei mir müssen Sie Ihren literarischen Intellekt unter Beweis stellen.“ Die meiste Zeit verstand ich nicht mal, was sie mir eigentlich sagen wollte. Aber ihre zusammengekniffenen Augenbrauen, ihre finsteren Augen und ihr harscher Ton machten den Inhalt überflüssig. Was nicht für meine Präsentation, geschweige denn für meine Hausarbeit galt. Noch schlimmer waren nur meine Kommilitonen. Sie fielen mir mit irgendwelchen Fremdbegriffen ins
Wort, erzählten von Theaterinszenierungen in Wien und Prag und sagten vor dem Kurs, dass sie mir mit ihrem Zwei-Minuten-Monolog mehr beigebracht hätten als meine Eltern in 18 Jahren Erziehung. Ich wollte den Kurs schmeißen. Aber ich konnte nicht mal eben in einen anderen Hörsaal wechseln oder mich bei der Studienberatung für ein spontanes Auslandssemester informieren. Es gab nur die
Augusthitze in meinem Dachgeschoss, die digitale Bib auf meinem Laptop und meine Überforderung zwischen Powerpoint-Folien von Annie Ernaux. Ich hörte Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung,aber nicht, um danach zu handeln, sondern um mich mit Worten abzulenken, die ich halbwegs
verstand. Ich sah mich als Opfer und meine Scheuklappen sahen mich entweder mit einem Bachelor-Abschluss in einem Großkonzern oder mit einem Schlafsack unter der Brücke.
Irgendwann kam ein Punkt, in dem mein Ehrgeiz völlig siegte. So sehr, dass ich mich mit jeder Faser meines Körpers ins Leisten stürzte. Monatelang gab es für mich nichts anderes mehr als Lesen,Lernen und Schreiben. Meine Professorin merkte es nicht, oder es war ihr schlichtweg egal. Denn
obwohl ich mich 24/7 mit dem Leben der französischen Schriftstellerin befasste, sämtliche Literaturkritiken auftrieb und sogar meine Kenntnisse aus dem Französisch-Leistungskurs wiederbelebte, um Interviews und Rezensionen in der Originalsprache zu lesen, machte sie mir deutlich, dass meine Leistung sich nicht mal um einen halben Notenpunkt verbesserte: „Sie können
zwanzig Jahre versäumte Kulturbildung nicht mit einem Semester aufholen“, sagte sie, als ich ein italienisches Theaterstück ansprach, auf dass ich bei meiner Recherche gestoßen war.
110 Prozent reichen nicht? Gut, dann kommen jetzt 120 Prozent, dachte ich und wurde noch
extremer, besessener, selbstzerstörerischer. Ich versuchte, mir die Begriffe, die meine Kommilitonen erwähnten, aufzuschreiben. Teilweise notierte ich ganze Sätze. Ich versuchte, mich durch ihre Sprache
anzupassen, dazuzugehören, zu bestehen. Und nebenher noch die zwanzig Jahre Theater- und Opernerfahrung durch YouTube-Aufzeichnungen nachzuholen, jede Woche das neue Seminarbuch zu lesen und meine Hausarbeit mit „Substanz“ zu füllen. Meine Professorin wollte, dass ich über den gesellschaftlichen Aufstieg schrieb, der wohl irgendwo zwischen den Zeilen stand. Ich nahm die Meinung irgendeines renommierten Literaturkritikers an, demnach der Aufstieg gelungen sein soll. „Ein Aufstieg in Ernaux Position ist unmöglich. Sie kann noch so viele akademische Titel besitzen, sich
wie die Elite kleiden, ihre Sprache und Kultur annehmen – sie wird immer eine Außenseiterin sein. Jeder wird auf den ersten Blick erkennen, dass sie nicht dazu gehört“, befand allerdings meine Professorin.
Mein Gehirn fing an, sich alles zurecht zu biegen. Ich sei wie Ernaux, es gebe keine Chance für mich, ich muss unter die Brücke, egal wie viel ich leiste. Kurz vor Abgabeschluss fiel mir ein Satz aus einer
Rezension, die ich schon 1000 Mal gelesen hatte, wieder ins Auge und ging nicht mehr aus meinem Gedankenkarussell raus: „Annie Ernaux sucht nach einem dritten Ort.“ Mein nicht literarisch gebildeter Kopf dachte, dass der erste Ort ihre Familie war, der zweite die akademische Gesellschaft, in der sie durch ihren zumindest auf dem Papier existierenden Aufstieg als erwachsene Frau lebte.
Und der dritte Ort musste wohl irgendwas dazwischen sein. Ich verabscheute Ernaux, obwohl ich sie nicht mal kannte. Die hatte schließlich Luxusprobleme. Was für dritter Ort diggah. Ich wäre froh, ich hätte einen Ort. Ich habe kein Zuhause und keinen Campus, weil ich seit Monaten beides auf 40
Quadratmetern Dachschräge lebe.
Dieser Ort, der bloß in einem Satz von abertausenden Seiten Sekundärliteratur stand, war allerdings noch das einzige, auf das ich eine Reaktion hatte. Die Abwertung meiner Professorin und meiner Kommilitonen ließ mich schon lange kalt. Auch mit der Pandemie hatte ich abgeschlossen, weil sich ja doch seit zwei Jahren nichts änderte. Und sonst gab es nichts in meinem Leben, weil ich Tag und
Nacht nur leistete und meine Pausen Frühschichten beim Bäcker waren. Aber dieser dritte Ort, der machte mich wütend. Zornig. Hasserfüllt. Ich schrieb über den Ort in den Schlussworten meiner Hausarbeit.
Ich bestand den Kurs mit einer 3,3. Nicht, weil ich am Ende doch noch etwas über den
gesellschaftlichen Aufstieg verstanden, die Elite-Sprache gelernt hätte oder zur Theaterkennerin geworden wäre. Das machte mir meine Professorin mehr als deutlich. Ich bestand, weil ich „authentisch unter Rückbeziehung auf die autobiographischen Tendenzen Ernaux“ über den dritten
Ort geschrieben habe. Vielleicht war es, weil ich mich trotz all meinen Bemühungen doch nicht zu 100 Prozent selbst verleugnet hatte und etwas von mir gegeben hatte. Vielleicht war es, weil Wut die Funktion hat, mein Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss zu stärken. Vielleicht war es auch, weil ich hinter dem Leistungsdruck ein verletztes Kind gefunden hatte, was für zehn Zeilen gehört werden wollte.
Wenn ich meinen Leistungsdruck loslasse, höre ich auf, meine Bedürfnisse zu betäuben und sehe wieder klar, was ich wirklich brauche, um mir und der Welt ein Stückchen mehr Akzeptanz, Frieden und Liebe zu geben.